 Auf dem „Communityportal für Bildung Medien und Lernkulturen“ der Universität in Krems, hat Prof. Michael Wagner einen kritischen Beitrag mit dem Titel „Wider den Begriff Web 2.0“ verfasst, den ich sehr, sehr lesenswert finde. Wagner kritisiert darin, einerseits den zunehmend inflationären Gebrauch des Begriffs selbst, aber auch den Gebrauch der mittlerweile zur Ikone aufgestiegenen Endung „2.0“ für alle möglichen Dinge. Diese Kritik findet statt vor dem Hintergrund, dass der Begriff selbst kaum eine griffige Definition hat. Genau dies kritisiert Wagner indem er schreibt:
Auf dem „Communityportal für Bildung Medien und Lernkulturen“ der Universität in Krems, hat Prof. Michael Wagner einen kritischen Beitrag mit dem Titel „Wider den Begriff Web 2.0“ verfasst, den ich sehr, sehr lesenswert finde. Wagner kritisiert darin, einerseits den zunehmend inflationären Gebrauch des Begriffs selbst, aber auch den Gebrauch der mittlerweile zur Ikone aufgestiegenen Endung „2.0“ für alle möglichen Dinge. Diese Kritik findet statt vor dem Hintergrund, dass der Begriff selbst kaum eine griffige Definition hat. Genau dies kritisiert Wagner indem er schreibt:
Man sollte eigentlich Bezeichnungen wählen, die so wenig Interpretationsspielraum wie möglich erlauben.
Wagner plädiert daher dafür, sich an der Definition des MIT zu orientieren, Zitat:
Dort spricht man im Zusammenhang mit Web 2.0 von partizipativen Technologien. Der Begriff der „Partizipation“ soll dabei zum Ausdruck bringen, dass der Konsument oder die Konsumentin nicht mehr passiv Medien konsumiert sondern selbst aktiv an einem kollaborativen Medienproduktionsprozess beteiligt ist.
Dem kann ich mich nur anschließen. Das stimmt aus meiner Sicht auch gut überein mit anderen Sichtweisen, die den Wandel darin sehen, dass es eine Entwicklung vom „Read-only-Web“ zum „Read-and-Write Web“ gibt. Diese Definition allein erklärt aus meiner Sicht aber noch nicht die Dynamik die wir sehen.
Wieso sollten plötzlich so viele Menschen etwas Eigenes „produzieren“ oder schreiben wollen? Prinzipiell ging das ja schon mit den ersten Homepages. Nein, ich glaube wer zu Beginn des Internet im Netz etwas schreiben wollte, der hätte das auch tun können (vielleicht war es komplizierter, teurer und langsamer als heute, aber wenn man gewollt hätte…). Ich denke vielmehr, dass die Dynamik der Netzentwicklung, die oft mit „Web 2.0“ bezeichnet wird einen anderen Motor hat. Dieser Motor ist etwas flapsig ausgedrückt das Prinzip „Gleich und Gleich gesellt sich gern“! Es ist die in den Webdiensten integrierte Funktion bzw. ein diesen Diensten inhärenter Algorithmus, der Menschen anhand von Content den sie produzieren (z.B. Weblog Post mit einem Tag, delicious Bookmark mit Tag, Flickr-Bild mit Tag) und den sie konsumieren (z.B. Youtube-Film mit Tag, SlideShare-Folien mit Tag, Amazon-Buch mit Collaborative Filtering, iTunes Store mit Collaborative Filtering) zusammenführt. (Dank an dieser Stelle an Heidi Schelhowe für die Anregung zu dieser Algorithmus-Sichtweise.)
Der dynamische Motor ist das soziale Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und einer Verbindung zu anderen „gleichen“ oder doch zumindest ähnlichen Nutzern. Die Partizipation allein ist aus meiner Sicht deshalb eher Mittel zum Zweck, um ein eigenes Interessenprofil bekannter zu machen, Interessenten werden dann über die zugegeben recht primitiven Profile (auf „Tag“ bzw. Schlagwort-Basis und z.B. via Trackbacks) zusammengeführt. Das funktioniert trotz oder gerade wegen der Einfachheit erstaunlich gut, weil die Schlagworte und Trackbacks von Menschen ausgewählt und gesetzt werden. Ich sehe nicht, dass unbedingt ein neuer, revolutionärer Wille zur Partizipation da wäre, aber ich sehe, dass ein ursoziales Bedürfnis nach Gemeinsamkeit bzw. Gemeinschaft die treibende Kraft hinter „Web 2.0“ ist. Das hat man erst kürzlich z.B. an dem Studentenportal studi.vz gesehen, dort ist es die gemeinsame Uni, und die gemeinsamen Gruppen und das „gruscheln“, die Menschen zusammenführen.
Wagner schließt mit dem Fazit:
Aus dem Begriff des „partizipativen Web“ ergeben sich somit einige sehr zentrale Fragenstellungen mit derzeit noch wenig zufriedenstellenden Antworten.
Für mich ergeben sich nicht gleich in erster Linie Fragestellungen, sondern zuerst sehe ich neue Möglichkeiten und Chancen. Die Fragestellungen tauchen erst auf, wenn ich von den neuen Chancen tatsächlich Gebrauch mache und auch mit neuen Folgen bzw. Konsequenzen Bekanntschaft mache. So ist es z.B. durch das „Read-and-Write Web“ viel viel leichter geworden, jemanden wildfremdes im Web durch einen vielleicht etwas harsch oder unachtsam formulierten/geschriebenen Blog-Kommentar zu verärgern. Eine zentrale Frage ist für mich: Wie sieht für diesen Fall die kulturelle Routine aus zur Formulierung von Kommentaren in Weblogs?
- Lasse ich es wegen dieses Risikos am Besten ganz bleiben?
- Schreibe ich Kommentare lieber nur dann, wenn ich ganz „helle Momente“ habe und sondere nur Geniales ab?
- Blogge ich nur mit einem zwischengeschalteten Lektor, der Ausdruck und Rechtschreibung prüft, damit ich mich nicht mit meiner schlechten Rechtschreibung und den Tippfehlern völlig diskreditiere?
- Übe ich Disziplin und formuliere stets so als wäre mein virtuelles Gegenüber der einflußreichste Mensch des Planeten, dem ich antworte?
- Gibt es Routinen zur Entschärfung von möglichen Kommentar-Konflikten, die ich lernen kann?
- Mache ich vor jedem Kommentar ein Profiling des Blogbesitzers mittels Google, nach dem Motto „Wer ist das?“, „Was für einen Status hat er?“, „Was hat er in der Vergangenheit geschrieben?“
- Versuche ich einen Mittelweg zu gehen und probiere aus, welche Grenzen es gibt, mit dem Risiko sie vielleicht auch mal zu überschreiten?
- Beteilige ich mich besser überhaupt nicht am Web 2.0, denn das könnten meine zukünftigen Arbeitgeber lesen und die haben ja vielleicht gar kein Verständnis für so viel Präsenz ihrer zukünftigen Mitarbeiter im Web?
Update 24.5.2007
Folgenden Film musste ich einfach hier noch anfügen. Er ist unterhaltsam und zugleich macht er einen durch seine Übertreibung wirklich nachdenklich.
Trotz des aufkommenden Web 2.0-„Bashing“ das grade umgeht, muss man ja nicht von einem Extrem ins andere fallen. Ich sehe die positiven Seiten der Internetdynamik und wie man es dann benennt ist eigentlich zweitrangig. (Gefunden via weiterbildungsportal.ch)
Why do I blog this? Zum einen zeigt für mich die inflationäre 2.0-Ikonik auch langsam aber sicher heftige Abnutzungserscheinungen, zum anderen ist der Begriff aus meiner Sicht von vergleichbarer „Nebelkerzen“-Qualität wie der Begriff des Lernobjekts. Ohne klare Begriffe ist jedoch – zumindest in der Wissenschaft – nichts mehr klar. Ein weiterer Grund für dieses Posting erschließt sich nur aus dem kommunikativen Kontext für die beteiligten Personen. :-) Ich hoffe die Geste wird verstanden.


 So, seit langer Zeit bin ich endlich dazu gekommen in Sachen Podcasting mal wieder nachzulegen. Ich habe mir meinen Chef „geschnappt“ und ihm gesagt, dass es viel zu schade ist, die Erfahrungen und Eindrücke, die er auf seiner Finnlandreise gemacht hat für sich zu behalten. Daher habe ich ihm über 20 Minuten lang einmal Löcher in den Bauch gefragt bzw. nachgefragt, was eigentlich „YouLearning“ ist. Sein Vortrag ist ja schon in einigen Weblogs aufgetaucht, nun war es aus meiner Sicht auch mal an der Zeit, vielleicht noch ein paar Details zu diesem Vortrag zu erfahren.
So, seit langer Zeit bin ich endlich dazu gekommen in Sachen Podcasting mal wieder nachzulegen. Ich habe mir meinen Chef „geschnappt“ und ihm gesagt, dass es viel zu schade ist, die Erfahrungen und Eindrücke, die er auf seiner Finnlandreise gemacht hat für sich zu behalten. Daher habe ich ihm über 20 Minuten lang einmal Löcher in den Bauch gefragt bzw. nachgefragt, was eigentlich „YouLearning“ ist. Sein Vortrag ist ja schon in einigen Weblogs aufgetaucht, nun war es aus meiner Sicht auch mal an der Zeit, vielleicht noch ein paar Details zu diesem Vortrag zu erfahren.
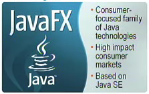 Eine kleine Sensation hat sich diese Woche ereignet. Auf der
Eine kleine Sensation hat sich diese Woche ereignet. Auf der  Offenbar haben einige gemerkt, dass das Aufbohren des Webbrowsers mit JavaScript-Bibliotheken nicht die „ultima ratio“ für sichere und zuverlässige, optisch ansprechende Userinterfaces sein kann. Es läuft nun scheinbar Stück für Stück auf Client-Applications hinaus, die harmonisch mit dem OS zusammenspielen und die grafischen Fähigkeiten des OS für ein gutes Userinterface nutzen. Sun nennt das
Offenbar haben einige gemerkt, dass das Aufbohren des Webbrowsers mit JavaScript-Bibliotheken nicht die „ultima ratio“ für sichere und zuverlässige, optisch ansprechende Userinterfaces sein kann. Es läuft nun scheinbar Stück für Stück auf Client-Applications hinaus, die harmonisch mit dem OS zusammenspielen und die grafischen Fähigkeiten des OS für ein gutes Userinterface nutzen. Sun nennt das